Mehr als 5,7 Millionen Menschen in Deutschland erhalten heute Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung. Ihre Zahl hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Die hohen Kosten treiben den Beitragssatz der Pflegeversicherung auf einen historischen Höchststand. Dennoch müssen Heimbewohner im ersten Jahr fast 3.000 Euro zusätzlich aus eigener Tasche zahlen. Um die Betroffenen zu entlasten, wird eine Pflegevollversicherung gefordert. Doch die Ausweitung umlagefinanzierter Leistungen kann angesichts der demografischen Verwerfungen keine zukunftsfähige Lösung sein, sagt Dr. Jochen Pimpertz. Wir sprachen mit dem Leiter des Kompetenzfelds Staat, Steuern und Soziale Sicherung am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) über Reformalternativen.
Die umlagefinanzierte Soziale Pflegeversicherung ist auf den demografischen Wandel nicht vorbereitet. Die Kosten für die Beitragszahler steigen rasant. Warum eine Pflegereform auf private, kapitalgedeckte Vorsorge setzen muss, erklärt der Ökonom Dr. Jochen Pimpertz.
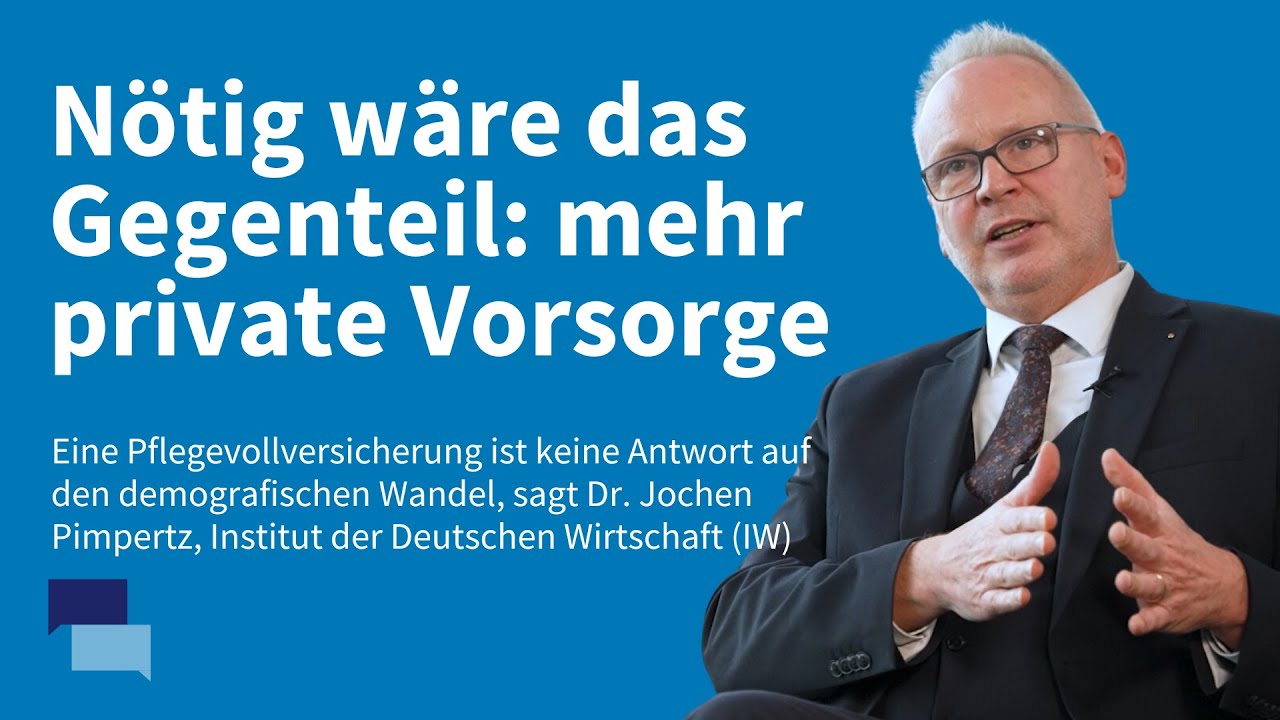
Nicht nur in der Krankenversicherung steigen die Beiträge, auch in der Pflegeversicherung sind die Beiträge zuletzt stark gestiegen. Gleichzeitig steigen aber auch die Eigenanteile, die die Bewohner von Pflegeheimen aus der eigenen Tasche zahlen müssen. Einige plädieren deshalb für eine Pflegevollversicherung. Was halten Sie von dieser Idee?
Ich halte das für eine sehr gefährliche Idee. Nicht, dass mir das Schicksal derer, die tatsächlich finanziell überfordert sind, nicht am Herzen läge. Aber es braucht andere Antworten. Denn der demografische Wandel in der umlagefinanzierten Pflegeversicherung wird erst in zehn Jahren voll durchschlagen. Typischerweise steigt das Pflegefallrisiko im hochbetagten Alter jenseits des 75. Lebensjahrs deutlich an.
Erst in zehn Jahren werden die geburtenstarken Jahrgänge erstmals dort ankommen und die Zahl der zu versorgenden Pflegebedürftigen in die Höhe schnellen lassen. Wenn wir heute zusätzliche Leistungsversprechen geben, kostet das nach Berechnungen des IGES-Instituts für die Bundesregierung heute rund 0,4 Beitragssatzpunkte. Der Sockel, auf dem dann die demographisch bedingten Beitragssatzsteigerungen aufsetzen, wird also heute erhöht, um dann in der Zukunft die Probleme zu verschärfen. Nötig wäre genau das Gegenteil: mehr private Vorsorge. Und zwar idealerweise in einem anwartschaftsgedeckten Versicherungsmodell.
7 von 10 Haushalten wären in der Lage, stationäre Pflegekosten bis zu 5 Jahre zu finanzieren – da muss man sich wirklich fragen, ob wir uns eine Pflegevollversicherung leisten wollen.
Durch eine Pflegevollversicherung würden also alle Pflegebedürftigen entlastet. Sind denn alle Pflegebedürftigen auch auf diese zusätzlichen Leistungen angewiesen?
Nach unseren Untersuchungen, unter anderem zuletzt für den PKV-Verband, bestehen daran erhebliche Zweifel, weil sich der Wohlstand im Alter eben nicht nur aus dem laufenden Alterseinkommen speist, sondern in vielen Fällen auch aus dem Vorsorgevermögen, das vorher aufgebaut wurde. Und das muss dann eben im Falle eines Risikoeintritts, Pflege zum Beispiel, eingesetzt werden. Und da haben wir festgestellt, dass im Grunde genommen 7/10 Haushalte in Deutschland in der Lage wären, wenn sie ihr Vorsorgevermögen einsetzen würden, die steigenden Pflegekosten bei einer stationären Unterbringung für eine Person für bis zu fünf Jahre aus eigener Kraft zu finanzieren.
Angesichts solcher Zahlen muss man sich wirklich fragen, ob wir uns eine Pflegevollversicherung leisten wollen. Denn sie schützt das vorhandene Vermögen. Das mag die Erben freuen. Aber diejenigen, die kein Vermögen haben, als Beitragszahler oder als Hochbetagte, haben nichts davon, weil alle Beitragszahler gleich viel beitragen müssen.
Alle Experten sind sich einig, dass die umlagefinanzierte soziale Pflegeversicherung eine nachhaltige Finanzreform braucht. Wie könnte eine solche Finanzreform aussehen?
Wir müssen im Grunde genommen das, was solidarisch, beitragsfinanziert zur Verfügung gestellt wird, deckeln und wir brauchen als zweite Säule eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge, um in der Summe den steigenden Finanzierungsbedarf abbilden zu können.
Wenn wir auf eine solche anwartschaftsgedeckte Versicherungslösung verzichten, bedeutet das, dass wir sukzessive immer größere Lasten auf unsere Kinder und Enkel abwälzen. Ob diese das in Zukunft mittragen werden, ist eine offene Rechnung. Man kann darüber spekulieren. Es ist aber auch denkbar, dass sich die Menschen in Zukunft nicht mehr für ein solches Umlagesystem entscheiden, egal wie auch immer sie da rauskommen. Und dann fehlen erst recht die Mittel, um diejenigen, die medizinische und pflegerische Versorgung brauchen, auch wirklich versorgen zu können.










